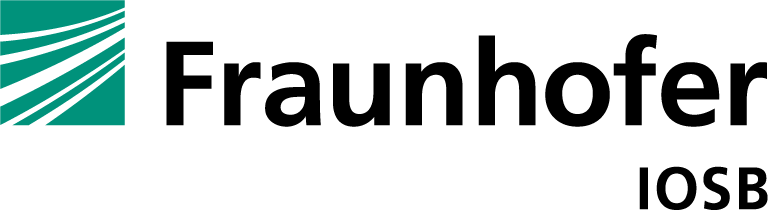Warum wir KI brauchen, um zu erkennen, was Assistenzsysteme noch nicht sehen können
Täglich bewegen wir uns scheinbar aufmerksam durch den Straßenverkehr – doch wie präsent sind wir wirklich? Kognitive Ablenkung beim Fahren zählt zu den meistunterschätzten Risiken der Verkehrssicherheit. Deshalb fordert EuroNCAP Industrie und Forschung auf, bis 2029 Systeme zur Erkennung kognitiver Ablenkung in alle Serienfahrzeuge zu integrieren. Während visuelle und manuelle Ablenkungen – wie das Tippen am Handy – schon lange im Fokus stehen, bleibt eine andere Gefahr oft unerkannt: Gedanken, die abschweifen. Ein Fahrer kann einen Fußgänger sehen – und trotzdem nicht reagieren. Warum? Weil seine Gedanken woanders sind.
Was ist kognitive Ablenkung?
Von kognitiver Ablenkung spricht man, wenn sich die Aufmerksamkeit des Fahrenden von der Fahraufgabe auf innere Gedanken verlagert. Im Gegensatz zu anderen Formen der Ablenkung bleiben Hände und Augen dort, wo sie sein sollen – aber der Kopf ist nicht bei der Sache.
Psycholog:innen wie David Strayer (University of Utah) und Natasha Merat (University of Leeds) erforschen dieses Phänomen seit Jahren. Strayers Studien zeigen: Selbst freihändiges Telefonieren kann Reaktionszeiten und Gefahrenwahrnehmung erheblich verschlechtern. Merats Fahrsimulator-Experimente verdeutlichen, dass geistig abgelenkte Fahrer oft nicht auf kritische Ereignisse reagieren – selbst wenn sie diese direkt ansehen. Solche „Looked-but-failed-to-see“-Fehler gehören zu den häufigsten Unfallursachen an Kreuzungen.
Auch am Fraunhofer IOSB beschäftigt sich der Psychologe Dr. Frederik Diederichs mit dem Thema. Er entwickelte die sogenannte BABS-Skala zur BABS-AF weiter, die das Ablenkungspotenzial von Gesprächen – mit Mitfahrenden, am Telefon oder mit Chatbots beim Automatisierten Fahren – bewertet. Je stärker ein Gespräch das bewusste Nachdenken (System-2-Denken nach Kahneman) fordert, desto höher die kognitive Ablenkung. Dazu kommt die Einteilung von Nebentätigkeiten in Ablenkungsklassen. Ursprünglich wurde die Skala in einer Porsche-geförderten Dissertation entwickelt, um die Aufmerksamkeit beim sportlichen Fahren zu bewerten.
Stand der Forschung
In den letzten 20 Jahren wurde kognitive Ablenkung vor allem im Labor und im Fahrsimulator erforscht – mit Methoden wie:
- Selbsteinschätzungsskalen, z. B. NASA-TLX zur mentalen Belastung
- Zweitaufgaben, etwa Kopfrechnen, die N-Back Aufgabe oder Telefongespräche während der Fahrt
- Reaktionszeittests, bei plötzlichen Ereignissen
- Blickverhalten, z. B. längere Fixationen, weniger Augenbewegungen
- Physiologische Messungen, z. B. Herzratenvariabilität, Pupillenerweiterung oder EEG-Signale (fehlendes P300)
Diese Verfahren liefern valide Ergebnisse – allerdings nur unter kontrollierten Bedingungen. Für den Serieneinsatz im Auto sind sie oft zu aufwendig, zu langsam oder zu invasiv. Bislang fehlt ein robuster, nicht-invasiver Weg, kognitive Ablenkung im realen Straßenverkehr zuverlässig zu erkennen.
SensAI: Der digitale Zwilling unseres Denkens
Genau hier setzt der Fraunhofer-Ansatz SensAI an. Ziel ist es, eine multimodale KI zu entwickeln, die den kognitiven Zustand der Fahrerin oder des Fahrers anhand mehrerer Datenquellen einschätzen kann:
- Computer Vision erkennt Blickverhalten, Körperhaltung, Aktivitäten und Intentionen (Technologie des Fraunhofer IOSB)
- Sprachanalyse erfasst Sprachinhalt, Tonlage, Tempo und Sprechpausen (Technologie des Fraunhofer IDMT)
- Physiologische Bildsignale werden genutzt, um Atmung und Puls aus Kameradaten abzuleiten (Technologie des Fraunhofer IMS)
Aus diesen Signalen erstellt SensAI einen kognitiven digitalen Zwilling – ein Echtzeitmodell des mentalen Zustands. So erkennt das Fahrzeug, ob die fahrende Person überfordert, unkonzentriert oder innerlich abwesend ist – selbst wenn sie äußerlich aufmerksam wirkt.
Vom Labor auf die Straße: Sicherheit durch vorausschauende KI
Ein Beispiel: An einer Kreuzung nähert sich von der Seite ein Radfahrer. Der Fahrer blickt in die Richtung – sieht den Radfahrer aber nicht bewusst. Kurz darauf kommt es zum Unfall.
Hätte das Fahrzeug auf den kognitiven digitalen Zwilling zurückgreifen können, hätten die Assistenzsysteme reagiert: mit einem Hinweis, einem Warnton oder sogar einer sanften Bremsung.
Das ist keine Science-Fiction, sondern angewandte KI-Forschung made by Fraunhofer.
Ausblick
Kognitive Ablenkung ist unsichtbar – aber nicht unmessbar. Mit multimodaler KI schließen wir die Lücke zwischen Labordiagnostik und Serienfahrzeug. Vprhaben wie SensAI können zeigen, wie Fahrzeuge künftig nicht nur die Straße, sondern auch ihre Fahrenden im Blick haben – und damit einen echten Beitrag zu Sicherheit und Fahrkomfort leisten.